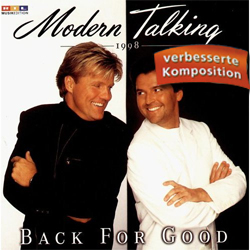Schulfest beim Sohn. Eine der Attraktionen: ein offensichtlich selbstgebautes Gerät, bei dem man mit Tennisbällen auf eine Zielscheibe wirft, und das einem bei einem Treffer in hohem Bogen etwas entgegenschleudert…
Als ich sehe, was da in hohem Bogen aus der Maschine geflogen kommt, entfährt es mir begeistert: „Geil, ein Negerkusskatapult!“ Die Menge um mich herum verstummt, immer mehr Augenpaare wenden sich mir zu. Erschrocken, geringschätzend, tadelnd. In einem Steve-Martin-Film wäre jetzt noch die Musik ausgegangen und ich fände mich in einem Scheinwerferkegel wieder. „Das sagt man nicht mehr!“, zischt eine Dame neben mir. Ich überlege kurz, ob sie mein „Geil!“ zu eighties fand, aber, na ja, „Lässig!“ sagt man ja auch nicht mehr, und der Ausruf „Porno!“ war nur kurz in dem Spätneunzigern mal „in“, und wäre außerdem meinem Alter und dem Schauplatz – einem Schulhof – nicht angemessen gewesen. Aber natürlich ist mir ja auch schon längst klar, mit welchem Teil meines Wortschatzes ich soeben aufgelaufen bin. Es war der Neger.
Ich empfand das Wort „Neger“ nie als beleidigend oder sonstwie negativ belegt, habe es allerdings auch so gut wie nie außerhalb der Kombination mit „Kuss“ verwendet. Wofür auch, in meinem Wohnort gab es niemanden, den als solchen zu bezeichnen auch nur Sinn ergeben hätte. Aber gut, wenn ich etwas tun kann, um dem Rassismus Einhalt zu gebieten, dann bin ich dabei. Lasse ich es also künftig bleiben, das Wort „Negerkuss“ zu verwenden. Ich hänge nicht daran. Ganz früher hieß das Ding wohl auch mal „Mohrenkopf“, und wir fanden als Kinder den Begriff so uncool, dass wir betreten mit den Augen gerollt haben, wenn Opa uns in der Bäckerei einen bestellt hat.
Und, ja, ich habe es mitbekommen, dass die Negerküsse irgendwann umbenannt worden sind, ich weiß nur nicht mehr, in was. Ich habe seit ca. 25 Jahren keinen mehr gegessen. Schmeckt ja auch scheiße.
Also, wie heißen diese Zuckerschaumklopse denn heutzutage? Neben mir ein begeisterter Konsument im Kindesalter, der müsste es wissen. Schließlich badet er gerade sein Gesicht darin. „Wie heißt denn das was Du da isst?“ frage ich ihn. „Keime Ahmump“ sickert es dumpf aus seinem ausgeschäumten Mundraum. Nachdem er nur eine Sekunde später den Mund wieder frei hat, fügt er hinzu „Schoko…dinger, oder so.“ und leckt sich die Kakaoglasur vom Daumen. Der Rest des Schokodingerbezugs landet in kunstvollen braunen Streifen auf seinem Manuel-Neuer-Trikot, bereits das mit den vier Sternen.
Na gut, dann wird die Anstandsdame von eben es bestimmt wissen. „Sagen Sie mal. Wie sagt man denn heute dazu?“ erkundige ich mich bei ihr. „Na, Schokoküsse.“ entgegnet sie wissend. „Mama! Warum denn ‚Küsse‘?“ fragt von rechts unten ein ebenfalls einer Zuckerschaumparty entsprungenes halbwüchsiges Wesen. Offenbar ihr Sohn. „Mamaaaaa!“ wiederholt er, noch bevor Mama eine Chance gehabt hätte, zu atmen. „Warum sagt man ‚Küsse‘ dazu?“
Da haben wir’s. Das Kind ist also ebenfalls von der Namensgebung irritiert, aber nicht von dem Part mit dem Neger, sondern wegen des Kusses. Mama ist ratlos, aber ich lasse sie mit Sohn und Argumentationszwang alleine, schließlich hat sie angefangen. Hätte sie – wie ich vier Stunden später – Wikipedia zu Rate gezogen, hätte sie ihrem Sohn erklären können, dass der „Kuss“ eine Übersetzung der französischen Bezeichnung „baiser“ für den süßlichen Bauschaum ist, der dem Gebäck innewohnt und, ach, lesen Sie doch einfach selber.
„Bei uns hießen die immer Dickmann’s.“ erinnert sich ein Herr neben mir. „Sind se aber nich. Sind die vom Aldi.“, weiß ein weiterer Herr. Und ein dritter vermutet, „Ich glaube, die haben gar keinen Namen mehr.“
Tatsächlich? Ein Gegenstand, der aus sprachhygienischen Gründen ersatzlos seines Namen beraubt wurde?
„Hm…“ Der zweite Herr begutachtet sorgfältig die Form des Dings, das seine Tochter soeben auffing und ihm triumphierend vor die Nase hält. „Vielleicht ‚Afro-Meiler‘?“ Herr Eins atmet sichtbar Kaffee aus seiner Nase aus.
Sind eigentlich im Zuge des Namensverlustes die Dickmann’s-Umsätze massiv eingebrochen? Wie vermarktet man eigentlich ein Produkt, dessen Name tabu ist? Und unter welchem Namen bestellt der Supermarkt sie beim Großhandel? „Zweihundert Packungen von, Sie wissen schon, knick-knack“ klingt wenig business-like, und könnte obendrein zu ungewollten Lieferungen von, sagen wir, Kondomen oder Bild-Zeitungen führen.
Auf dem Heimweg begegne ich noch einmal der Anstandsdame mit ihrem ausgeschäumten Sohn. „Mama, mir ist schlecht!“, jammert der.
Der jüdische Komiker Oliver Polak sagte jüngst in einem Interview mit der Zeitschrift „brand eins“: „Political Correctness bedeutet, sich mit einem Missstand nicht auseinanderzusetzen. Die Forderung nach Verboten ändert nichts am eigentlichen Missstand.“ Der Missstand bei der Konditoreiware-die-nicht-genannt-werden-darf ist meineserachtens nicht ihr Name, sondern ihre bloße Existenz.
Obwohl, sieht schon geil aus, wenn so’n „Schokokuss“ aus dem Katapult mit Schmackes auf den Boden klatscht. Porno.